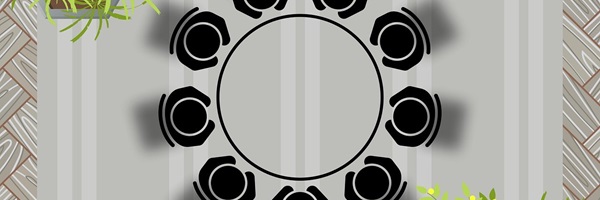Was ist Asperger Autismus ?
Der Asperger-Autismus gehört zu den nicht sichtbaren Behinderungen. Für die Betroffenen selbst und für deren Angehörige kann der Asperger-Autismus eine oftmals erhebliche lebenslange Leidenssituation bedeuten.
Beim Asperger-Autismus handelt es sich um eine nicht sichtbare Behinderung aus dem Formenkreis des hochfunktionalen Autismus, d.h. die Betroffenen sind normal intelligent und verfügen häufig über soziale Anpassungsstrategien, die ihre besondere Art der Behinderung oftmals erst spät offenbar werden lassen („Masking“).
Bei vielen Betroffenen wird das Vorliegen eines Asperger-Autismus deshalb erst erkannt und diagnostiziert, wenn sich infolge ihrer Behinderung bereits Co-Morbiditäten, wie Depression, Neurosen und Angst- oder Zwangsstörungen, entwickelt haben.
Denn es geschieht allzu oft, dass Asperger-Betroffene aufgrund ihrer autistischen Veranlagung, die gekennzeichnet ist durch eine veränderte Wahrnehmung und ein verändertes Kommunikationsverhalten, Begleit- und Folgeerkrankungen entwickeln, die Asperger-Menschen in Situationen der sozialen Ausgrenzung und Isolation geraten lassen können, was für die Betroffenen selbst und auch für deren Angehörige eine lebenslange außerordentliche Leidenssituation herbeiführen kann.
Wenn ihre Umgebung hingegen dazu bereit ist, die speziellen Schwierigkeiten und die besonderen Bedürfnisse von Asperger-Autisten zu erkennen und anzunehmen, so kann das den Betroffenen dabei helfen, ihre eigenen und oftmals hervorragenden Qualitäten zu entwickeln und ein weitgehend selbst bestimmtes und glückliches Leben zu führen.
Asperger-Autisten leiden schnell unter einer Überflutung durch Reize
Fast alle Asperger-Autisten leiden unter Hyperästhesie, das bedeutet im neurologischen Sinne eine Sensibilitätsstörung, die eine Überempfindlichkeit auf Reize beschreibt.
Eine besondere Empfindlichkeit besteht bei Betroffenen häufig auf das Hören, also Hyperakusie, das ist eine außergewöhnliche Empfindlichkeit gegenüber normalen Umgebungsgeräuschen, wie z.B. das Reden anderer Personen. Die besondere Empfindlichkeit kann aber auch alle anderen Sinne betreffen, z.B. liegen häufig auch Überempfindlichkeiten gegen Licht, gegen Gerüche und gegen Berührungen vor.
Die Reizüberflutung durch Hörgeräusche und andere Sinnesreize kann bei Betroffenen zu einer psychischen Überlastung („Overload“) und zu reflexhaften Reaktionen wie Schweißausbruch oder Herzrasen bis hin zum psycho-vegetativen Zusammenbruch führen („Meltdown“), bei dem es beim Betroffenen häufig zu Ausrastern und hysterischem Schreien kommen kann; der Betroffene kann sich selbst schlagen und verletzen, Dinge können herumgeworfen werden. Der Betroffene verliert die Kontrolle über sein Handeln.
Der „Shutdown“ tritt ein, wenn der Betroffene einem Overload und Meltdown nicht entrinnen kann. „Shutdown“ bezeichnet den völligen Rückzug in sich selbst. Die meisten Autisten sind in diesem Stadium nicht mehr ansprechbar und sie brauchen absolute Ruhe, um sich von diesem Zusammenbruch zu erholen.
Um dem drohenden Shutdown entgegenzuwirken, benutzen viele Asperger-Autisten Strategien eines selbst stimulierenden Verhaltens, „Stimming“, wie z.B. Händeflattern, Hin- und Her-Schaukeln, Wippen oder Springen, aber auch Lautäußerungen, wie beispielsweise Summen oder das Aufzählen bestimmter Dinge („Stimming“ = self stimulating behaviour).
Das Stimming hat auf viele Autisten eine beruhigende und Sicherheit gebende Wirkung.
Asperger-Autisten haben eine andere Wahrnehmung und ein anderes Kommunikationsverhalten als neurotypische Menschen
Indem Asperger-Autisten oftmals große Teile ihres Bewusstseins mit erheblicher Konzentration auf ganz spezielle Sinnzusammenhänge richten, deren Strukturen und Qualitäten sie ganz und gar auszuloten bestrebt sind, können sie dabei Dinge, die anderen, neurotypischen Menschen wichtig sind, übersehen.
Aufgrund dieser Asperger-typischen Neigung zu „Spezialinteressen“ bekommen neurotypische Menschen oftmals den Eindruck, dass die Wahrnehmung von Asperger-Autisten gegenüber ihrer eigenen Sichtweise eingeschränkt und verzerrt ist.
Das Engagement, mit dem sich Asperger-Autisten den von ihnen gewählten speziellen Sinnzusammenhängen widmen, erscheint neurotypischen Menschen oftmals als übertrieben und die Wachsamkeit, mit der Asperger-Autisten die von ihnen gewählten speziellen Sinnzusammenhänge beständig im Fokus haben, erscheint neurotypischen Menschen oftmals als unflexibel und starr.
Die Nachdrücklichkeit und die Kompromisslosigkeit, mit der Asperger-Autisten die von ihnen gewählten speziellen Sinnzusammenhänge betrachten und vertreten, kann neurotypischen Menschen als eindimensional und dogmatisch erscheinen.
Alle diese Besonderheiten in der Wahrnehmung führen dazu, dass die Kommunikation zwischen Asperger-Autisten und neurotypischen Menschen häufig erschwert ist:
Während Asperger-Autisten, häufig mit großer Begeisterung, versuchen, ihre neurotypische Umgebung von der Schönheit, Größe und Wichtigkeit ihres gewählten Spezialinteresses zu überzeugen, erfährt die neurotypische Umgebung solche Ausführungen oftmals als wunderlich, krude, beharrend, einseitig, unzugänglich, langweilig und möglicherweise sogar als verbohrt, rechthaberisch und dogmatisch.
Ihre besondere Art der Kommunikation kann Asperger-Autisten leicht in Konflikt- und Mobbing-Situationen mit neurotypischen Menschen führen
Indem Asperger-Autisten ihre Umgebung anders wahrnehmen als neurotypische Menschen und ihre Art der Kommunikation auf neurotypische Menschen oftmals andersartig und befremdlich wirkt, kann es im Umgang mit neurotypischen Menschen oftmals zu Konfliktsituationen und daraus erfolgenden Mobbing-Situationen kommen.
Dies kann noch verstärkt werden durch die Tendenz, dass Asperger-Betroffene in vielen Fällen ein anderes Nähe-Distanz-Bedürfnis haben als neurotypische Menschen, d.h. Asperger-Betroffene empfinden körperliche Nähe oftmals bereits als problematisch an einem Punkt, an dem bei neurotypischen Menschen noch keine Abwehrgefühle aufkommen, und generell kann man sagen, dass Asperger-Betroffene ein erhöhtes Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug haben.
Die Erfahrung eines beständigen Scheiterns ihrer Kommunikationsversuche und ihrer sozialen Anpassungsversuche führt bei Asperger-Autisten häufig zu schweren Folgeerkrankungen, bis hin zu einer erhöhten Suizidneigung
Um soziale Konfliktsituationen zu vermeiden, versuchen Asperger-Betroffene im Umgang mit neurotypischen Menschen häufig über lange Zeiträume, sich zu verstellen und übermäßig anzupassen („Masking“); eine Anstrengung, die am Ende so gut wie immer zum Scheitern verurteilt ist.
Die Erfahrung des beständigen Scheiterns ihrer Kommunikation und ihrer sozialen Beziehungen führt bei Asperger-Betroffenen oftmals zu Krankheiten wie Angst- und Panik-Zuständen, Depression und übermäßiger Selbstisolation, die mit einer erhöhten Tendenz zum Suizid einhergehen kann.
Als heilsam empfinden Asperger-Autisten eine reizarme Umgebung, Routinen im Alltag und die Akzeptanz ihres Rückzugsbedürfnisses durch ihre Umgebung
Bedenkt man, dass fast alle Asperger-Autisten unter einer oder mehreren Formen der Hyperästhesie, insbesondere auch Hyperakusis, leiden, so wird deutlich, dass für Asperger-Betroffene eine reizarme Umgebung heilsam wirken kann.
Routinen bei Alltagsbetätigungen können dazu führen, dass Asperger-Betroffene im täglichen Leben die Sicherheit (zurück)gewinnen können, die ihnen durch ihre anders geartete Wahrnehmung und die daraus sich beständig ergebenden Konfliktsituationen mit ihrer Umwelt verloren gegangen ist.
Die generelle Übereinkunft, „Nein sagen“ und sich zurückziehen zu dürfen, auch ohne Worte benutzen zu müssen, also z.B. durch den Einsatz von Gesten, Schildern oder anderen Zeichen, kann Asperger-Betroffenen dabei helfen, ihre extremen Selbstisolierungstendenzen aufzugeben, so dass sie es wieder wagen können, sich menschlicher Nähe anzunähern und diese auch zu genießen.
Begriffserklärungen
Overload (= Überladung, Reizüberflutung)
Nervenzusammenbruch aufgrund Überlastung
Der Overload ist eine Überbelastung, die infolge einer Reizüberflutung entsteht. Geräusche, Bilder, Gerüche – alles strömt ungefiltert auf den Autisten ein. Autisten können wichtige und unwichtige Dinge nicht voneinander trennen und filtern. So entsteht Chaos im Kopf. Das Durcheinander von Eindrücken und Gefühlen führt zu einer totalen Reizüberflutung.
Einige Autisten versuchen sich vor den drohenden Zusammenbrüchen durch das Aufsetzen von Kopfhörern zu schützen oder durch sogenanntes Stimming.
Meltdown (= Kernschmelze)
Wutausbruch / Der Druck muss raus
Besteht keine Möglichkeit, sich bei einem Overload zurück zu ziehen, kann es zu einem Meltdown kommen.
Es gibt Symptome, die einen bevorstehenden Meltdown ankündigen, wie z.B. Kopfschmerzen, starke innere Unruhe, noch stärkere Licht-, Geruch-, Geräusch- und Berührungsempfindlichkeit, Weglaufgedanken, stärkere Gereiztheit und ähnliche Körperreaktionen wie auch der Overload selbst. Der Meltdown ist also oft eine Folge des “missachteten” Overloads.
Ein Meltdown kann auch durch Stress ausgelöst werden.
Wenn es zu einem Meltdown kommt, kommt es beim Betroffenen häufig zu Ausrastern, hysterischem Schreien, der Betroffene kann sich selbst schlagen und verletzen, Dinge können herumgeworfen werden. Der Betroffene verliert die Kontrolle über sein Handeln.
„Stimming“ steht für „Self-stimulating behavior“:
Es ist ein sich selbst stimulierendes Verhalten, wie z.B. Händeflattern, Hin- und Her-Schaukeln, Wippen oder Springen, aber auch Lautäußerungen, wie beispielsweise Summen oder das Aufzählen bestimmter Dinge.
Das Stimming hat auf viele Autisten eine beruhigende und Sicherheit gebende Wirkung.
Rebound:
Der Begriff Rebound oder Absetzeffekt (von engl. rebound ‚Rückprall‘) bezeichnet in der Medizin das verstärkte Wiederauftreten von Symptomen einer medikamentös behandelten Erkrankung nach Absetzen der Arzneimittel (wikipedia).
Masking:
Um gesellschaftlich teilhaben zu können, kopieren Menschen aus dem Autismus-Spektrum neurotypisches Verhalten. Doch diese Anpassung kann für autistische Menschen ungesund und gefährlich werden. Masking ist keine Entscheidung, sondern ein Anpassungsmechanismus, der Autisten ein Leben in einer neurotypischen Welt möglich macht. Es ist ein Versuch, Resonanz zu erzeugen, wo nur selten Resonanz ist. Das ist erschöpfend, frustrierend und führt häufig zu Folgeerkrankungen, allen voran der Depression. Je besser ein Kind in der Schule ist und je schlimmer die Zusammenbrüche nach der Schule sind, desto mehr maskieren sie.
BZF-Kraft: (= Beratungs- und Förderkraft):
Beratungs- und Förderzentren (BFZ) koordinieren die sonderpädagogischen Angebote und die inklusive Beschulung der Schülerinnen und Schüler an allgemeinen Schulen in Kooperation mit Förderschulen und außerschulischen Institutionen.